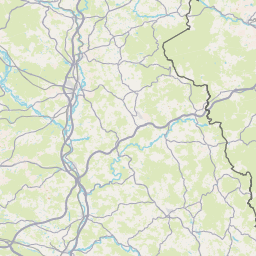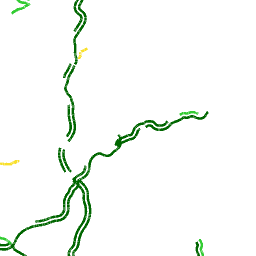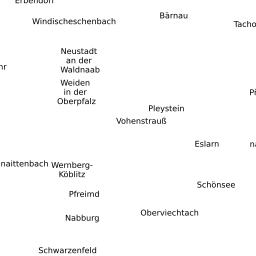Meinung Warum wir aus dem Palästina-Israel Krieg kein muslimisches Thema machen sollten
"Muslime, distanziert euch", heißt es immer wieder. Aber wer sind denn die Muslime? Es nützt niemanden, die Vielfalt dieser Community zu vernachlässigen, vor allem nicht dem gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus, kommentiert Nabila Abdel Aziz.

„Muslime, distanziert euch!“ heißt es zur Zeit immer wieder, auch von Vertreter*innen der hochrangigen Politik, wie Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, Vize-Kanzler Robert Habeck oder Innenministerin Nancy Faeser. Dabei ist die große Frage: Über wen sprechen wir da eigentlich?
Deutschland hat eine der vielfältigsten muslimischen Communities der Welt. Muslim*innen hier kommen aus der Türkei, aus Eritrea, aus Usbekistan, Djibouti, Indonesien oder Algerien. Sie sind sunnitisch, schiitisch, ahmedi, sufistisch oder alevitisch. Manche sind in Moscheen oder Verbänden organisiert, noch mehr gehören zu keiner Gemeinde. Einige gehen freitags in die Moschee, andere so gut wie nie. Ein immer größer werdender Teil ist wenig bis gar nicht religiös oder ist atheistisch. Muslimisch an ihnen ist nur ihre Familiengeschichte und vielleicht ihre Kultur und ihre Traditionen.
Niemand verlangt von „den Bayern“, sich von Antisemitismus zu distanzieren.
„Die muslimische Community“ ist untereinander uneinig, teilweise zerstritten. Wenn man sie überhaupt als Community definieren kann: Sie hat keine repräsentativen Sprecher, denn nur ein Achtel der hier lebenden Muslim*innen engagiert sich in einer Moscheegemeinde. Dennoch wird dieser vermeintlichen „Gruppe“ immer wieder abverlangt sich zu distanzieren, von Terrorgruppen oder Regimen, mit denen sie nichts zu tun haben.
Die Gesellschaft misst hier mit zweierlei Maß: Niemand verlangt von „den Bayern“, sich von Antisemitismus zu distanzieren. Obwohl insgesamt über vier Millionen Menschen bei der letzten Landtagswahl einer Partei ihre Stimme gaben, die entweder mit einer antisemitischen Flugblatt-Affäre auf sich aufmerksam gemacht hat oder vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Auch Muslime dürfen Individuen sein
Wenn gerade alles gut läuft, dürfen muslimische oder muslimisch gelesene Menschen Individuen sein. Doch das ändert sich, sobald es irgendwo auf der Welt Gewalt gibt. Oder Menschen Gewalttaten feiern, wie direkt nach dem Terroranschlag der Hamas, was selbsterklärend menschenverachtend ist. Doch es ist nicht zielführend, dann Millionen von Muslimen in Deutschland für die Taten eines Bruchteils verantwortlich zu machen. Warum verurteilen wir die Hamsas-Unterstützer jetzt in erster Linie als „Muslime“? Wir könnten sie auch als „Faschisten“ oder „Antisemiten“ oder als „religiöse Fundamentalisten" verurteilen. Die Kategorie "Muslime" ist viel zu groß und unpräzise. Sie nimmt zu viele Menschen in Sippenhaft.
Es ist ein Problem, wenn wir aus dem Krieg in Israel und Palästina immer und immer wieder ein muslimisches Thema machen. Weil wir so einer äußerst diversen Gruppe einen Konflikt geradezu aufdrücken, zu dem viele eigentlich keinen unmittelbaren Bezug haben: Muslime aus Bosnien, dem Senegal oder Marokko zum Beispiel. Oder Uiguren oder Kurden, die eigene Konflikte oder Genozid-Erfahrungen haben, die ihre Lebensgeschichte prägen. Erst dadurch, dass in Deutschland Muslim*innen ständig gezwungen werden, sich zu dem Konflikt zu verhalten, wird er identitätsstiftend. Schon Kinder und Jugendliche werden an Schulen mit dem Thema in die Ecke gedrängt.
Extremisten wollen Juden und Muslime gegeneinander ausspielen
Die Frage ist, ob das eine gute Idee ist, besonders, wenn wir Interesse daran haben, den Antisemitismus (auch unter Muslim*innen) wirklich zu bekämpfen. Zahlreiche Studien zeigen: Wenn sich Menschen marginalisiert und kollektiv verurteilt fühlen, beschäftigen sie sich eher nicht mit internen Problemen, sondern, im Gegenteil: Sie radikalisieren sich. So gewinnt man keien Verbündeten im Kampf gegen Antisemitismus. Natürlich sind es nicht nur Deutsche, die aus dem Konflikt einen muslimischen machen. Viele Regime in muslimisch-geprägten Ländern nutzen den Israel-Palästina-Konflikt, um ein Feindbild zu generieren und sich als Retter unterdrückter Muslim*innen zu inszenieren. Sie nutzen den Krieg für eigene Zwecke und lenken damit von innenpolitischen Schwierigkeiten ab. Sie kreieren ein muslimisches „Wir“ gegen ein israelisch-jüdisches „sie“ für ihren Antisemitismus und geben die Feindschaft zu Israel in Schulen, Universitäten und Medien weiter.
Doch gerade deswegen sollte man sich hier anders verhalten und nicht dem Kalkül der Extremisten wie zum Beispiel dem iranischen Regime entsprechen, die genau dieses Ziel haben: Eine Spaltung von Muslimen und nicht-Muslimen. Sie wollen ein ahistorisches Verständnis des Konflikts durchsetzen, das Muslime und Juden als ewige Feinde sieht. Dabei war die politische Bewegung in Palästina säkular geprägt, bis die Hamas in den späten achtziger Jahren an Zuspruch gewann.
Eine Demokratie muss Individuuen wahrnehmen und schützen können
Was die „Islamisierung“ des Israel-Palästina-Konflikts auch ausblendet: Eine große Zahl der hier lebenden Muslim*innen ist selbst vor fundamentalistischen Regimen geflohen. Die Opposition zum Dschihadismus besteht für sie nicht nur aus wohlfeilen Social Media Post, sondern hat sie ihre Heimat gekostet.
Was bedeutet das für uns? Wir können entscheiden, diese Polarisierung zu bremsen, indem wir eine Sprache finden, die nicht verallgemeinert, die nicht von „den Muslimen“ und „den Arabern“ spricht, sondern Menschen erlaubt, Individuen zu sein. Viele Muslim*innen haben das Gefühl, niemals vollwertige Bürger*innen dieses Landes sein zu können. Wer sie sind, was sie geleistet haben, wie sie leben, hat plötzlich keine Bedeutung mehr. Wenn dann im gleichen Atemzug mit der Diskussion über Antisemitismus noch von Abschiebungen die Rede ist und die FDP dafür plädiert, dass Versammlungsrecht für Ausländer einzuschränken, wissen Muslim*innen, wer damit vor allem gemeint ist. Das Versprechen, mit dem man hier aufwächst, hat sich für sie nicht erfüllt: Dass man in einer Demokratie als Individuum anerkannt wird, und nicht als ewige Vertreter*in einer Gruppe. Vielen Jüdinnen und Juden geht es ähnlich. Das Privileg von Individualität haben scheinbar nicht alle in dieser Gesellschaft.