 |
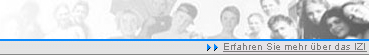 |
|
David Morley
Familienfernsehen und Medienkonsum zu Hause Im Familienfernsehen spielen auch künftig geschlechtsspezifische Medienaneignung und Programmnutzung eine wichtige Rolle - trotz heftiger Kritik an den Ergebnissen entsprechender Forschungsarbeiten. Vorwort Das Thema Familienfernsehen und häuslicher Medienkonsum ist heute in der Forschung traditionell stark vertreten - ein beachtlicher Teil davon aus feministischer Perspektive. Und so wird bei der Analyse in diesem Bereich der Frage nach dem Geschlecht eine zentrale Rolle eingeräumt, was in dieser Form nicht immer der Fall war. Bei Kulturstudien zum Beispiel haben sich feministische Arbeiten klar herauskristallisiert; sie lassen sich anhand der Beiträge von Brundson (1981), Hobson (1982), Ang (1985) und Radway (1988) zurückverfolgen. Eine Zusammenfassung dieser Arbeiten als "Standardwerk" erfolgte erst kürzlich. Die Invasion der Medien Heute erleben unsere Wohnungen eine fortwährende Invasion unterschiedlicher Informations- und Kommunikationseinrichtungen (Telefone mit Anrufbeantwortern und anderen Zusatzeinrichtungen, Computer, Videogeräte und eine Auswahl an elektronischem Spielgerät) und Haushalte mit mehr als einem Fernsehgerät sind zur Norm geworden, ebenso die wachsende Ausbreitung von individuellen Kommunikations- und Informationsdiensten wie z.B. Funkrufempfänger, Handys, Walkmans und CD-Geräte. Gerade in diesem sich verändernden technischen Umfeld ist es immer weniger sinnvoll, das Fernsehen isoliert von den anderen Technologien zu betrachten, mit denen es immer stärker verbunden ist. Das gab auch den Anstoß für die Entwicklung des Forschungsprojekts "The Household Uses of Information and Communication Technologies" (HICT), an dem ich (zusammen mit Roger Silverstone und Eric Hirsch) an der Brunel Universität in den späten 80er-Jahren beteiligt war (siehe Morley und Silverstone 1986; Silverstone und Hirsch 1992). In diesem Projekt verankert war die wesentliche und fundamentale Rolle des Kontexts, in dem der Medienkonsum stattfindet. Somit ging es - wie in dem früheren "Family Television"-Projekt - auch um Dinge wie geschlechtsspezifische und generationsbedingte Unterschiede (und um Haushaltstruktur sowie häusliche Gewohnheiten), um die Art und Weise des Medienkonsums zu bestimmen. Gegen die vorherrschende Debatte des technologischen Determinismus - wonach es oft heißt, dass diese neuen Technologien "Auswirkungen" haben (die die "Gesellschaft" oder das Familienleben eindeutig verändern werden) - setzte sich dieses Projekt insbesondere zum Ziel, die Rolle der verschiedenartigen Haushaltsstrukturen (und -kulturen) zu untersuchen und festzustellen, wie die einzelnen Mitglieder eines Haushalts den Stellenwert (oder auch die Bedeutungslosigkeit) der verschiedenen neuen Geräte in ihrem Leben bewerteten. Damit dies gelang, wurden im Forschungsdesign - der bewährten Tradition der so genannten "aktiven Zuschauerforschung" folgend - die Haushaltsstrukturen und -kulturen eher als unabhängige als als feste Variablen behandelt. Das Hauptinteresse aus dieser Perspektive liegt darin, für welches der angebotenen Kommunikationsmedien sich die Mitglieder der verschiedenen Haushaltstypen, die sich in unterschiedlichen sozio-kulturellen Situationen befinden und Zugriff auf verschiedenartiges kulturelles Kapital haben, schließlich entscheiden - und in welcher Weise sie dann die Technologie auf ihre eigene, unverwechselbare Art einsetzen. Die vielen ethnographischen Einzelheiten der Brunel-Studie erlaubten es uns tatsächlich, zumindest einige der komplexen Verquickungen von Bedeutung und Symbolismus zu begreifen, mit denen heute Fernsehgeräte beschrieben werden. Der Fernseher ist nicht mehr das totemistische Symbol des "Kaminfeuers", um das alle im "trauten Heim" herumsitzen. Es hat nunmehr seinen Platz als ein Gerät von vielen in einem sich rasant verändernden Umfeld eingenommen, in dem die verschiedenen Familienmitglieder oft ihren persönlichen Fernsehgewohnheiten im eigenen Zimmer nachgehen - mit einem multifunktionalen Bildschirm, der immer öfter an andere technische Einrichtungen angeschlossen ist. Hier erwies sich die kontextuelle Analyse im Projekt als hilfreich, da wir auf diese Weise Einsichten in die Abläufe einer beachtlichen Reihe von entscheidenden Prozessen innerhalb eines Haushalts bekamen, zu denen das Einhalten von Grenzen und die Identitätsfindung der einzelnen Haushaltsmitglieder (insbesondere der Kinder) zählte, und zwar durch bestimmte Regeln beim Einsatz der verschiedenen Kommunikationseinrichtungen - ob Fernseher, Telefon oder Computer. Die Gefahr der Verallgemeinerung Jedes Forschungsdesign hat jedoch auch Grenzen. Daher bedeutete das Engagement für eine intensive, kontextuelle und ethnographische Untersuchung, dass wir uns nur mit einer kleinen Anzahl von Haushalten beschäftigen konnten. Aufgrund von zeitlichen und etatmäßigen Beschränkungen, die auch in meinem vorangegangenen Projekt "Family Television" bestanden, traf man außerdem die Entscheidung, nur einen Haushaltstyp zu untersuchen - Kleinfamilien mit noch unselbstständigen Kindern. Es liegt auf der Hand, dass dieser Typ Haushalt Priorität bei Studien genießt, zumal er nach wie vor ideologisch wie moralisch als die zentrale Lebensform - entsprechend dem heutigen sozialen und politischen Verständnis - empfunden wird. Jedoch bedeutet der stetige statistische Rückgang dieses Haushaltstyps überall in den westlichen fortschrittlichen Gesellschaften und die damit verbundene Vermehrung anderer Haushaltstypen, wie z.B. allein erziehende Elternteile und Alleinstehende, dass jegliche Verallgemeinerungen, abgeleitet von Forschungsergebnissen zu diesem - wenn auch wichtigen - Haushalttypus, mit großer Vorsicht behandelt werden müssen. Man kann mit Berechtigung sagen, dass für den Bereich Medienforschung Untersuchungen zum häuslichen Medienkonsum in unterschiedlichen Haushaltstypen und sozialen Umfeldern zu einer dringenden Priorität geworden sind. Die Frage, inwieweit sich Forschungsergebnisse verallgemeinern lassen, ist immer schwierig. Bei der Durchführung meiner "Family Television"-Studie, deren Teilnehmer fast ausschließlich Familienhaushalte weißer Hautfarbe mit Kindern waren, die hauptsächlich in Stadtgebieten der unteren Mittelschicht/Arbeiterschicht wohnten, achtete ich sehr darauf, dass meine Ergebnisse nur im Zusammenhang mit dieser Bevölkerungsschicht betrachtet wurden. Dennoch habe ich in den darauf folgenden Jahren mit Bestürzung festgestellt, dass manche Erkenntnisse meiner Studie von anderen ganz einfach verallgemeinert wurden. Insbesondere die Erkenntnisse über das Bestehen stark geschlechtsspezifischer Unterschiede bei den von mir befragten Männern und Frauen hinsichtlich des Programmgeschmacks und der Art und Weise, wie ferngesehen wird, wurden ganz allgemein als "grundlegender" Unterschied bei den Fernsehgewohnheiten aller Männer und Frauen ausgelegt. Wir befinden uns hier in einem komplexen Bereich, wie wir später noch sehen werden, und wie sehr ich diese Art der unsachgemäßen Verallgemeinerung auch ablehne, so wenig möchte ich auf dem Gegenteil bestehen (was bei Cultural Studies immer häufiger der Fall ist), das oft die Form eines "Anti-Essenzialismus" annimmt, der nur schwer von einem methodologischen Individualismus zu unterscheiden ist. Das "mediale" Heim In der oben erwähnten Studie zu den "Household Uses of Information and Communication Technologies", die ich zusammen mit Roger Silverstone und Eric Hirsch durchgeführt habe, bestand unser zentrales Interesse darin, einen analytischen Rahmen für das Verständnis der Rolle der verschiedene Kommunikationsmedien zu formulieren, und dafür, wie sie sich in Öffentlichkeit und Privatsphäre auswirken. Wie bereits erwähnt, wollten wir wissen, wie die jeweiligen Familien ihre verschiedenen technischen Einrichtungen, mit denen sie lebten, einsetzten, und wir wollten uns dabei allen von der Technik beherrschten Modellen entgegenstemmen, die einfach davon ausgehen, dass neue Technologien (in direktem, kausalen Prozess) zwangsläufig das Zuhause oder die Familie verändern. Nachdem wir tiefgehende Theorien im Zusammenhang mit der Macht der Technik verworfen haben, müssen wir folglich jedoch auch eingestehen, dass die verschiedenen Technologien ein "Doppelleben" haben, aufgrund dessen sie auf veschiedene Weise und in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden können - manchmal sogar zu völlig anderen als den ihnen ursprünglich zugedachten Zwecken. Aufgrund dieser widersprüchlichen Dynamik, und unter der Prämisse, dass diese Technologien nicht einfach Auswirkungen auf das Zuhause haben, sondern dass sie im Hinblick darauf analysiert werden müssen, wie sie sich in eine bereits bestehende häusliche Routine einfügen, bedeutet das ebenso, dass sie gleichzeitig auch Neues mit sich bringen, da sie dazu in der Lage sind, zwischen Mitgliedern des Haushalts und anderen Leuten an anderen Orten Kontakt herzustellen. Man kann also bei den Kommunikationseinrichtungen davon sprechen, dass sie einerseits dazu imstande sind, zu verbinden, was getrennt ist (sie bringen via Fernsehen die Welt von draußen in die Wohnung, sie stellen via Telefon Kontakt zu Freunden oder Verwandten irgendwo her), aber im gleichen Atemzug überschreiten sie auch die (möglicherweise geheiligte) Grenze, welche die Privatsphäre und den Zusammenhalt zu Hause vor der Überflutung und den Gefahren von außen schützt. Wenn heute ganz normal davon gesprochen wird, dass der Fernseher das Kaminfeuer als totemistisches Kernstück im Lebensraum einer Familie ersetzt hat (jetzt einmal abgesehen von meiner vorherigen Bemerkung, dass Haushalte immer öfter mehrere Geräte besitzen), sollten wir nicht außer Acht lassen, dass dieser Ersatz im wahrsten Sinne des Wortes in der Mitte des - symbolisch gesprochen - familiären Lebensraums stattgefunden hat: In unserer Kultur handelt es sich in jedem Fall um einen geheiligten Ort. Morse (1990) erwähnt insbesondere, dass das Fernsehen "auf Privatempfang in einem Umfeld, isoliert von den Geschehnissen ‘da draußen’, angelegt ist, welche die Lebensbedingungen außerhalb des Heims regeln". Es stellt sich somit die Frage, wie das Fernsehen (und andere Medien) "unser Idyll, diesen autarken, abgegrenzten Lebensraum [...], den Platz vor unserem Fernsehgerät" mit anderen, geographisch entfernten, jedoch kommunikationstechnisch anwesenden Orten verbindet. Medien und die Gestaltung häuslicher Routine In den vergangenen Jahren haben Untersuchungen, die den Einfluss der Medien auf die Routine des Alltags untersuchen, stärkere Anerkennung als ein wichtiger Teilbereich der Forschung erfahren. David Gauntlet und Annette Hill schreiben in ihrer Studie zum Thema "TV-Gewohnheiten in Großbritannien", dass das Fernsehen allem Anschein nach "zumindest als Katalysator für die Zeit- und Raumeinteilung dient - oder deutlicher: oft ist der Fernseher der wichtigste Faktor, wenn es um Entscheidungen im Zusammenhang mit der Raum- oder Zeitaufteilung im Alltag geht" (Gauntlet und Hill 1999, S. 38). Viele der von Gauntlet und Hill Befragten gaben an, dass sie ihre Abendmahlzeit normalerweise zu sich nehmen, währenddessen sie eine bestimmte Sendung verfolgen. Das Essen wird absichtlich zeitlich so eingeplant, dass es mit einer bestimmten Sendung zu dieser Uhrzeit zusammentrifft; dadurch funktioniert die Sendung zusammen mit dem Essen als fester Bestandteil der häuslichen Zeitplanung. Für Arbeitslose, Rentner oder ältere Personen, denen keine Zeitplanung von außen auferlegt wird, ist das Fernsehprogramm nicht selten unglaublich wichtig für die Strukturierung des Tagesablaufs, der sonst deprimierend gesichtslose, lange Zeitspannen hätte. In dem Maße, wie es als charakteristischer Teil des Heranwachsens empfunden wird, dass man Tag für Tag die Erlaubnis bekommt aufzubleiben, um bestimmte Sendungen anzusehen, genauso sind es beim Älterwerden die sich ändernden Sehgewohnheiten (Nachrichten und aktuelle Berichte). Für Arbeitslose ist diese Abhängigkeit vom Fernseher manchmal mit einer Kehrseite verbunden, und sie empfinden sie als eine mit Schuldgefühlen beladene Rückkehr zu kindlichen Mustern. Die Einbeziehung des Fernsehens in die räumlichen Gegebenheiten der Wohnung beeinflusst den organisatorischen Ablauf in einem Haushalt ganz wesentlich. Bezugnehmend auf die Aussage einer der befragten Personen, wonach zu Hause "jedes Familienmitglied an einem anderen Ort fernsieht: Mama und Papa im Wohnzimmer, meine Schwester im Schlafzimmer und ich normalerweise in der Küche", unterstreichen die Autoren, dass diese oder eine andere Art der routinemäßigen Verteilung bei 80% der von ihnen befragten Haushalte gang und gäbe ist (Gauntlet und Hill 1999, S. 242). Hier sehen wir einen Aspekt des groß angekündigten Schrittes hin zur Fragmentierung im häuslichen Fernsehkonsum. Hirsch sagt des weiteren über die Entwicklung der jüngsten Zeit in Großbritannien: "Neue Konfigurationen im Zusammenhang mit Fernsehen (die sich weniger auf den terrestrischen Empfang konzentrieren) in Form von Kabel, Satellit [und] Video [...] sowie die neue PC-Technologie [...] stellen sich in einem politisch-moralischen Umfeld der ‘Auswahl’ dar", die auf der Basis des persönlichen Geschmacks des Einzelnen getroffen wird, und nicht mehr vom Haushalt als Einheit (Hirsch 1998, S. 165). Silverstone beschäftigte sich näher mit dem Thema der oben erwähnten Fragmentierung innerhalb des Hauses und spricht vom Ausmaß der Gefahr, welcher die Zukunft der Familie selbst, wie allgemein angenommen wird, ausgesetzt ist, und zwar durch die Verfügbarkeit von "tragbaren, individuellen [...] ‘Privat’-Technologien" welche als "isolierende und fragmentierende Maschinen" funktionieren. Silverstone fährt in dieser düsteren Vision fort und geht noch über das Problem des Sich-aus-der-Öffentlichkeit-Zurückziehens hinaus, nämlich, dass dies nun auch zu Hause selbst passiert, und wir die Situation haben, in der "Eltern und Kinder damit beschäftigt sind, daheim ihre eigenen Kreise - zeitlich wie räumlich - zu ziehen, isoliert durch personalisierte Stereo-Systeme [...] aneinander vorbeiziehend wie Schiffe in der Nacht im dichten Nebel elektronischen Kommunikations- und Informationsüberflusses" (Silverstone 1991, S. 5). So betrachtet sorgen personalisierte Technologien (der Walkman, der Gameboy, die Spielkonsole, in vielen Haushalten mehrere Fernsehgeräte) für eine Fragmentierung der Familie oder des Haushalts - eine Wirkung, die Silverstone zufolge "noch von den Möglichkeiten des zeitversetzten Benützens vonVideorecorder und Mikrowelle verstärkt wird (Silverstone 1991, S. 12). Der Wunsch nach Abgrenzung innerhalb der Familie In vielen Fällen dürften die vielfältigen Möglichkeiten zum häuslichen Medienkonsum dazu beitragen, Interessenkonflikte zu vermeiden, ja sie sogar zu lösen. Konflikte und Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit Fernsehen oder anderen Medien sind sicher oft der Grund für Spannungen in Familie und Haushalt. In manchen Fällen gewinnt man den Eindruck, dass es den Leuten schwer fällt, die unterschiedlichen Auffassungen und Bewertungen der anderen Familienmitglieder in diesen Dingen zu tolerieren. Anhand der verteidigenden Aussage einer der Befragten in Lelia Greens Studie über die Fernsehgewohnheiten im australischen Outback, nämlich dass sie eine "Familie mit gutem Zusammenhalt" seien, und dass "im Allgemeinen alle dieselben Sendungen mögen", lässt sich vielleicht die Spitze des Eisbergs erahnen, mit welchen Ängsten die Tolerierung, Organisation und Handhabung der unterschiedlichen Auffassungen (also Konfliktpotenzial) innerhalb des Heims verbunden sind (Green 1998). Diese Dinge werden in der Regel anhand von Systemen zur Abgrenzung gelöst oder zumindest abgesteckt, mit denen die Familienmitglieder die Inanspruchnahme der jeweiligen (sich oft ergänzenden) tatsächlichen und/oder symbolischen Wohnräume aufteilen. So schreiben Graham Murdock und Kollegen in ihrer Studie, dass Kinder und Jugendliche die Zeit am Computer dazu nutzen, "Abstand und Privatsphäre innerhalb des Haushalts zu gewinnen und ihre Trennung und Unabhängigkeit von den Eltern zu unterstreichen [...]" (Murdock 1995, S. 255). In einem ausgeprägteren Fall geht es um einen jungen Mann, der noch zu Hause bei den Eltern lebt, und von dem Moores schreibt, dass er eine "maskuline Welt voll von technischen Einrichtungen, schnellen Autos und Science-Fiction-Phantasien" bewohnt, in der er eine Sammlung elektrischer Gegenstände zum Zeichen "eines Kampfes um ein begrenztes Maß an Autonomie angesichts der elterlichen Autorität" zusammenträgt. Bei diesem jungen Mann, wie auch bei einem anderen aus der HICT-Studie, dessen Familie sein Zimmer (ähnlich voll mit Apparaten) nur noch als seinen "Mutterleib" bezeichnete, ist das jeweilige Spezialgebiet in seinem individuellen symbolischen und tatsächlichen Lebensbereich innerhalb des Hauses stark ausgeprägt und wirkt dadurch auch als Grenze. Er drückt es so aus: "Ich bin der Einzige, der mit all den Geräten umzugehen weiß. Niemand kommt sonst in mein Zimmer - ich betrachte es als meinen Bereich... Hier oben kann ich ansehen, was ich will... Sobald ich in mein Zimmer gehe, fühle ich mich wie auf einem anderen Planeten" (Moores 1996, S. 37). Im Rahmen der HICT-Studie schreibt Eric Hirsch von den Spannungen, die sich in einem der Haushalte ergaben, als der Ehemann seinen Computer samt Zubehör ins gemeinsame Wohnzimmer stellte und damit einen Eingriff in den gemeinsamen Wohnraum vornahm. Als die Computeranlage schließlich erweitert wurde, so Hirsch, richtete jedes Familienmitglied eine andere (und zum Teil gegensätzliche) Erwartungshaltung an das neue Gerät. Ein und dasselbe Gerät (ein neues Computermodem) wurde vom Familienvater als "enormes Potenzial" empfunden, von seiner Frau als Bedrohung für die Benutzung der Telefonleitung, vom Sohn als spannende Möglichkeit zum Verschicken von E-Mails, und für die Tochter war es "im Vergleich zum Fernsehen nur von nebensächlicher Bedeutung" (Hirsch 1998, S. 167). Hirsch stellt fest, dass es für die Familie sehr schwierig war, die verschiedenen Interessenkonflikte zu schlichten, die durch den Erwerb dieser neuen technischen Einrichtung und deren mannigfaltigen Verbindungsmöglichkeiten mit der Welt draußen entstanden waren - und das bei einer Konstellation, in der die eine Anwendungsmöglichkeit die andere beeinträchtigt. Sicher hat die Einrichtung mehrerer Telefonleitungen in vielen Haushalten seit der Zeit der HICT-Studie einiges dazu beigetragen, manche dieser Unvereinbarkeiten auszuräumen, jedoch ändert sich an einem wesentlichen Punkt nichts, so lange verschiedene Mitglieder des Haushalts immer noch rivalisierende und gegensätzliche Prioritäten bei der Benutzung von im wesentlichen knapp bemessenen Ressourcen wie Geld, Zeit und Platz setzen. Die HICT-Studie unternahm u.a. den Versuch einer anthropologischen Herangehensweise, die sich auf die symbolische und rituelle Bedeutung von Gegenständen im Haushalt konzentrierte. Hieraus entstand eine weitere Arbeit, in der Hirsch eine Querverbindung zwischen den westlichen und so genannten primitiven Gesellschaften herstellte und in der er argumentiert, dass "wir uns eigentlich von den Melanesiern in der Art, wie wir Beziehungen durch materielle Gegenstände aufrechterhalten, nicht sonderlich unterscheiden" (Hirsch 1998b, S. 176). In einem besonders anschaulichen Beispiel für den Symbolismus, wie Kommunikationstechnologie domestiziert wird, berichtet er von einer Familie, in der alles technisch Anmutende auf Drängen der Ehefrau so weit wie möglich in nachgebauten antiken Schränken verschwand. Diese scheinbar unschuldige ästhetische Wahl lässt sich besser verstehen, wenn man weiß, dass das Familienleben in gerade diesem Haushalt ständig von Anrufen und Unterbrechungen gestört wird, die im Zusammenhang mit der Arbeit des Ehemannes als Polizist stehen - sehr zur Belastung seiner Frau. Vor diesem Hintergrund ist gut nachvollziehbar, warum seine Frau versucht, "jegliche Anzeichen einer aufdringlichen Technik, die vielleicht eine Beziehung zur Außenwelt anzeigt" zu verstecken; es ist ein Teil ihres Kampfes, "alle Zeichen für eine Verbindung zur Außenwelt auszulöschen, die sich in ihr Leben zu Hause einmischen könnten" (Hirsch 1998b, S. 177). Hier sehen wir ein eindrucksvolles Beispiel, wie wertvoll ein ethnographischer Ansatz beim Medienkonsum sein kann; Entscheidungsfindungen können in einen Kontext gebracht und somit besser verstanden werden. Einflussnahme des Geschlechts auf Medienkonsum und -nutzung Wie schon erwähnt, konzentrieren sich bei Studien zum Thema Familienfernsehen und häuslicher Mediengebrauch einige der Erkenntnisse auf die Frage des Geschlechts. Ich werde in diesem Abschnitt nun der Frage nach geschlechtsbeeinflussten Unterschieden beim Umgang mit Medien nachgehen und die Formen des Konflikts beleuchten, die dadurch gelegentlich entstehen. In diesem Zusammenhang greift Hirsch die Auseinandersetzung eines Ehepaares auf, die entstand, weil der Ehemann seinen tragbaren Computer ins Wohnzimmer stellte, damit er am Abend damit arbeiten konnte. Die Frau wollte, dass er ihn wieder dorthin zurückstellte, wo auch sein Arbeitsplatz war und wo er ihrer Meinung nach auch hingehörte, da er sonst im Weg war und ihr Mann "ihn überall dort hinstellte, wo er nichts verloren hatte" (Hirsch 1998b, S. 168). Aus anthropologischer Sicht stimmen die Bemerkungen der Frau genau mit Mary Douglas’ klassischer Definition von Schmutz überein. In diesem Fall ist ihrer Meinung nach die Arbeit des Ehemannes im Wohnzimmer "genauso fehl am Platz" wie Schmutz. Karen Fog-Olwig bemerkt ganz richtig in ihrem Kommentar zu Hirschs Analyse in dieser Studie, dass der Dreh- und Angelpunkt die Tatsache war, dass diese neuen Technologien innerhalb der Wohnung einen neuen Raum entstehen ließen, der effektiv nur von den Männern (und Jungs) des Hauses belegt wurde. Die daraus resultierenden Konflikte in diesen Haushalten, wie nun der angemessene Gebrauch dieser technischen Einrichtungen auszusehen hat, müssen nach Fog-Olwig so verstanden werden, dass diese sich durch das technologie-getriebene "Eindringen männlicher Domänen [... und ...] Aktivitäten" ergeben, "die bisher traditionell außer Haus passiert sind [...] und nun im Hause stattfinden, welches bisher traditionell vom weiblichen Geschlecht in der Eigenschaft als Hausfrau, Mutter, Ehefrau oder Erzieherin geprägt war" (Fog-Olwig 1998, S. 228). Offensichtlich spielt bei der Kluft zwischen den Geschlechtern unter anderem das geographische und kulturelle Umfeld eine Rolle. In der erwähnten Studie über die Sehgewohnheiten im ländlichen West-Australien schreibt Lelia Green, dass besonders in diesem Umfeld "das Geschlecht oft der entscheidende Faktor ist, welche Sendungen im Fernsehen angesehen werden, und wie dies stattfindet". Sie berichtet von den fast hysterischen Reaktionen der Männer in ihrem Bemühen, sich von den ihrer Meinung nach "verweiblichten" Sendungen zu distanzieren. Die Nachdrücklichkeit, mit der "rührselige" Sendungen wie z. B. Seifenopern abgelehnt werden, ist ein klarer Hinweis darauf, wie sehr auch weiterhin eisern an einer sehr eingefleischten Form von Männlichkeit festgehalten wird. Ein Befragter schildert es besonders anschaulich: "Ich gebe mir alle Mühe [Seifenopern] aus dem Weg zu gehen [...] Mir wird schlecht dabei [...] Sie machen mich verrückt. Ich halte sie nicht aus". Ein anderer vertritt die Meinung: "Die sind Bockmist - ich bin definitiv kein Seifenopern-Fan" (Green 1998, S. 175-176). Die Intensität, mit der die Männer Sendungen im Genre von Seifenopern (unabhängig von ihren tatsächlichen Sehgewohnheiten) ablehnen, zeigt, wie schwer es den Leuten fallen kann, (zumindest öffentlich) die ihnen zugeschriebenen geschlechtsspezifischen Eigenheiten hinter sich zu lassen. Im speziell von Green untersuchten kulturellen Umfeld ist es für einen Mann offensichtlich äußerst schwierig, sich konkret mit Sendematerial dieser Art zu identifizieren - auch wenn an anderer Stelle die Sehgewohnheiten vielleicht gar nicht so geschlechtsabhängig sind. All das zeigt, wie vorsichtig man in diesen Dingen mit Verallgemeinerungen umgehen muss. Ausgehend von Judith Butlers Ansicht, wonach Geschlecht nichts anderes als eine "stilisierte Wiederholung von Handlungen" ist, sagt Green, dass eine der Arten, mit der Geschlechtszugehörigkeit tatsächlich aufgebaut wird, darin besteht, geschlechtsspezifisch fernzusehen, dass also "eine Form, sich als Mann ‘männlich’ und als Frau ‘weiblich’ zu benehmen, über den Konsum bestimmter Sendungen stattfindet" (Green 1998, S. 172). Dieser Prozess zeigt sich insbesondere während der Pubertät, in der sich das Kind allmählich aus der tiefen Abhängigkeiten innerhalb der Familie in die Unabhängigkeit als geschlechtsbestimmter Erwachsener bewegt. Einer der Bereiche, der diese Entwicklung widerspiegelt, sind die Fernsehgewohnheiten. Das wenig geschlechtsspezifische Fernsehen des Kindes wird abgelegt zugunsten einer erwachsenen, geschlechtsbestimmten Programmauswahl. Green schreibt, dass es in ihrem Befragtenkreis sogar klare Indizien dafür gegeben hat, dass Mütter die Mädchen in dieser Phase zum Anschauen von Seifenopern ermuntert haben, und die Väter die Söhne für Sport gewinnen wollten, und zwar in einem Ausmaß, dass "junge Frauen, die mit ihren Vätern Sport, und junge Männer, die mit ihren Müttern Seifenopern angeschaut haben, allmählich feststellen mussten, dass ihr Sehverhalten nicht in das Schema ihrer anderen Altersgenossen passte und sie daher bald vom vertrauten Muster abließen", um sich den "Sehnormen" der anderen um sich herum anzuschließen (Green 1998, S. 190). Die disziplinierende Wirkung des Gruppenzwangs, besonders während der Pubertät, bindet die Jugendlichen auch heute noch stark an die den beiden Geschlechtern zugeschriebenen Merkmale. Geschlechter-Essenzialismus Hier besteht das Risiko, in eine unzeitgemäße Form von Geschlechter-Essenzialismus zu verfallen, der den geschlechtsspezifischen Strukturen eine zu deterministische Wirkung zuschreibt und dabei das Ausmaß nicht erkennt, in dem Geschlechtszugehörigkeit nicht immer prägend ist und die Leute demzufolge auch nicht immer und zwangsläufig "Gefangene ihres Geschlechts" sind. Im Zusammenhang mit der Frage nach Verhaltensmustern im Umgang mit Medien kritisieren David Gauntlet und Annette Hill sowohl meine frühere Arbeit als auch die Arbeiten einer Reihe feministisch orientierter Wissenschaftler dahingehend, dass wir beim Einfluss, den die Geschlechtszugehörigkeit auf Rollenverhalten und Subjektivität nimmt, zu deterministisch an die Sache herangegangen seien, und dass wir zu viel Gewicht auf "polarisierte Unterschiede bei den Vorlieben bzw. dem Gebrauch der Medien zwischen Männern und Frauen" (Gauntlet und Hill 1999) gelegt hätten. Kritik, wie sie z.B. von Gauntlet und Hill kommt, macht auch darauf aufmerksam, dass sich sowohl bei der Berufstätigkeit der Frauen als auch in den Haushaltsstrukturen Veränderungen ergeben haben, die auch dafür verantwortlich sind, dass die Einwirkung der traditionellen Geschlechterrolle im heutigen Leben - zumindest in den westlichen Industrieländern - an Bedeutung verliert. Diese beiden Punkte - zum einen die erkenntnistheoretische Einsicht über Verallgemeinerungen bei der Geschlechterrolle als solche (oder als Folgerung daraus bei jedweden anderen gesellschaftlichen Gruppen), zum anderen die grundsätzlich unterschiedlichen Verallgemeinerungen über heutige geschlechtsspezifische Strukturen - müssen getrennt voneinander behandelt werden. Im ersten Fall - hinsichtlich der Gültigkeit von Verallgemeinerungen bei der Geschlechterrolle an sich - sagt Susan Bordo, dass sich "eine Geschlechtszugehörigkeit nie in Reinform zeigt, vielmehr im Zusammenhang mit dem Lebensumfeld, das von einer Vielfalt an Einflüssen geprägt ist, die wiederum nicht säuberlich auseinander dividiert werden können. Das bedeutet jedoch nicht [...], dass Abstrahierungen oder Verallgemeinerungen bezüglich der Geschlechtszugehörigkeit methodologisch unzulässig wären oder dadurch Unterschiede auf schädliche Weise gleichgemacht werden" (Bordo 1990). Ich selbst habe an anderer Stelle ähnlich argumentiert, nämlich dass die post-strukturalistische Kritik des Essenzialismus bei der Beschwörung einer geschlechtsspezifischen oder anderen gesellschaftlichen Kategorie immer auch Gefahr läuft, in eine Form von methodologischem Individualismus zu verfallen, der einem letztlich nur noch übrig lässt, einzeln aufgeführte Geschichten von (logischerweise) unendlicher Vielfalt zu bringen (s. Morley 1997). Beim zweiten Punkt entspricht es nach Lage der Dinge meiner eigenen Auffassung, dass traditionelle Muster im Beziehungsgeflecht der Geschlechter erstaunlich zäh sind, und sie manifestieren sich, wie wir gesehen haben, oft in neuen Formen und unter veränderten Umständen. In einem Bereich beziehen sich Gauntlet und Hill in ihrer Argumentation insofern auf den Wandel der Zeiten, als dass sie behaupten, in geschlechtsspezifischen Angelegenheiten habe sich seit meiner und Grays Studien Mitte der 80er-Jahre einiges grundlegend geändert. Sie gehen sogar noch weiter und sagen, dass "ihrer Meinung nach Studenten der 90er-Jahre diese auf Geschlechtertrennung ausgerichtete Herangehensweise vollkommen ablehnen. Sie finden sie sinnverwirrend und lächerlich", auch wenn diese Vorstellungen vielleicht "vor 20 Jahren in gewisser Weise Sinn hatten". Ihre Studien aus jüngerer Zeit haben ergeben, dass es einerseits kaum Beweise für geschlechtsabhängige Fertigkeiten bei der Bedienung der einschlägigen technischen Einrichtungen (im Gegensatz zum Beispiel zu der sehr stark geschlechtsspezifisch ausgeprägten Aneignung von Video-Technologie, die sich in meiner und auch Grays Arbeit gezeigt hat), und dass andererseits kaum "deutlich weibliche oder männliche Vorlieben oder Interessenlagen" in der Art, wie Brundson, Gray und ich sie durchdiskutieren, festgestellt werden konnten. Zunächst akzeptiere ich ohne Frage, dass sich in Großbritannien in den vergangenen Jahren einiges geändert hat. Meine zusammen mit Gray (1992) durchgeführte Untersuchung zur geschlechtsbezogenen Aneignung der Video-Technologie als ‘Männerspielzeug’ fand zu einer Zeit statt, in der diese Technologie noch nicht sonderlich verbreitet war. Damals war es von einer neuen Technologie, die gerade erst begonnen hatte, sich einem größeren Kreis jenseits der Bastler und Tüftler zu erschließen, nicht anders zu erwarten, als dass sie anfänglich vor allem von technisch interessierten jungen Männern genutzt wurde, genauso wie dies zuvor beim Radio und später beim Computer der Fall war. In gleicher Weise geht es bei der ganzen "Domestizierung" einer solchen Technologie darum, dass der Prozess der "Demokratisierung" (vom Könner zum Laien) einher geht mit einer "Feminisierung", in deren Verlauf das Gerät benutzerfreundlicher gemacht wird. Es wäre somit geradezu überraschend, wenn eine etablierte Gebrauchs-Technologie wie Video immer noch stark geschlechtsabhängig genutzt würde, und ebenso, wenn die nächste Freizeittechnologie nicht auch wieder einen ähnlichen, zunächst stark geschlechtsorientierten, Entwicklungsweg nähme. Allerdings schließe ich mich weniger der Behauptung an, dass die Auffassung, es gäbe keine geschlechtsspezifischen Unterschiede beim Programmgeschmack, veraltet sei. Natürlich ist es wichtig zu erwähnen, wie stark sich zum Beispiel in Großbritannien das Genre der Seifenopern verändert hat, damit auch das männliche Publikum größeres Interesse daran findet. Es ergibt sich für mich daraus weniger, dass eine verhältnismäßig geringe Verlagerung in dieser Form dazu führen sollte, den grundsätzlichen Gedanken ganz zu verwerfen, nämlich dass es geschlechtsspezifische Fertigkeiten, Betrachtungsweisen und Geschmacksmuster gibt. Schlussfolgerung Mit dieser Retrospektive zur Arbeit über Familienfernsehen und häuslichen Mediengebrauch wollte ich in der Hauptsache die Kernfragen umreißen, um die es bei diesem Thema immer wieder geht. Dazu gehören das Forschungsumfeld und die Methodologie sowie die Struktur und die strukturelle Einordnung - insbesondere im Zusammenhang mit der Geschlechtszugehörigkeit. Ich hoffe, mir ist es gelungen, die Bedeutung der Arbeit in dieser Form zu vermitteln, auch wenn sie bei Kritikern unter Beschuss steht. Außerdem hoffe ich ganz besonders, dass ich anderen Ermutigung geben konnte, sich auch weiterhin und sogar noch intensiver dieser wie ich meine wertvollen Arbeit zu widmen, nämlich sich mit der ganzen Bandbreite von Familien und Haushalten zu beschäftigen, die die Welt von heute kennzeichnen.
Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen IZI Tel.: 089 - 59 00 21 40 Fax.: 089 - 59 00 23 79 eMail: izi@brnet.de internet: www.izi.de
Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers!  zum Seitenanfang zum Seitenanfang
|
|||||||||||||||||||||
| Das IZI
ist eine Einrichtung des Bayerischen
Rundfunks |

